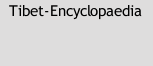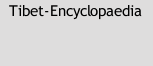|
Abbildung 1: Die erste Seite des Geomantie-Kapitels des Vaiḍūrya dkar-po. Links der Geomantie-Meister Kyung-nag und rechts die chinesische Prinzessin Un-shing kong-jo |
Geomantie in Tibet
Die tibetische Geomantie (sa-dpyad) hat das kulturelle Leben der Tibeter in der Vergangenheit stark geprägt und beeinflusst es bis heute. Geomantische Gesichtspunkte sind ausschlaggebend bei der Wahl eines Bauplatzes, sei es für ein Wohnhaus, ein neu zu errichtendes Kloster oder ein anderes sakrales Bauwerk, wie beispielsweise einen Stūpa.
Inhaltsübersicht
1. Erklärung des Begriffs Geomantie
2. Das 32. Kapitel des Vaiḍūrya dkar-po
3. Ungeeignetes Gelände
4. Die "Erdfeinde“
5. Geeignete Bauplätze
6. Der Nutzen von Geländebeschreibungen
7. Geomantische Vorstellungen und das Verhältnis der Tibeter zur Natur
8. Literatur
1. Erklärung des Begriffs Geomantie
„Geomantie“ kann auf zweierlei Weisen verstanden werden: Sie bezeichnet die Vorhersage künftiger Ereignissen anhand von Zeichen, die der Geomant wahllos oder nach festen Regeln auf dem Erdboden oder in Sand erzeugt. Dann interpretiert er sie und die damit verbundene Weissagung ist eine dem Zufall unterliegende Mantik, die man auch Punktierkunst nennt.
Zum anderen aber, und hierzu gehört die Geomantie in Tibet, ist Geomantie die Deutung sogenannter topographischer Merkmale der Erde, wobei die Landschaftsformen eines Gebietes oder das Aussehen einer bestimmten Örtlichkeit gedeutet werden. Der Geomant betrachtet und interpretiert die Gestalt eines Berges oder eines Felsens, einen Flusslauf, den Wuchs einer Baumgruppe oder eines einzelnen Baumes etc. und trifft damit – in der tibetischen Tradition häufig unter Anwendung von Berechungen aus den sino-tibetischen Divinationskalkulationen (nag-rtsis) – Vorhersagen für eine mögliche Nutzung. Man glaubt also, dass das Aussehen eines Gebietes gewisse Potenzen und Wirkungen habe, die ohne oder zusammen mit bestimmten Größen der nag-rtsis das Leben von Menschen beeinflussen.
Beide oben genannten Praktiken verwenden also wie auch immer geartete Formen und Zeichen, um die Zukunft oder eine bestehende Situation zu deuten. Die Punktierkunst jedoch ist ein allgemeines Mittel, die Zukunft vorherzusagen und dürfte aufgrund ihrer Methode und Zielsetzung als rein divinatorische Praktik zu betrachten sein.
Die Geomantie als Deutung von Merkmalen eines Ortes hingegen kann im Hinblick auf ein bestimmtes Ereignis angewendet werden: Ihre Vorhersagen hängen vor allem direkt mit der Errichtung von Gebäuden oder der Anlage von Leichenstätten zusammen. Hier dienen bereits bestehende und nicht eigens operativ erzeugte Muster zur Vorhersage. Diese Art der Geomantie bietet außerdem die Möglichkeit, künftige, bedrohliche Ereignisse durch geeignete Handlungen abzuwenden und ist somit als gesonderte Methode der Prognostik anzusehen.
Eigentliches Ziel der Geomantie ist es, Schäden zu erkennen, die auftreten können, wenn ein Gebäude an einer ungeeigneten Stelle oder mit - aus der Sicht der Geomatie -innenarchitektonischen Mängeln gebaut wurde. Die Wahl des passenden Grundstücks und die durch die Geomantie empfohlene Bauweise sollen Schäden verhindern. Stehen die Gebäude bereits, können Rituale Folgeschäden abwehren. Die Geomantie wird angewendet, um drohende Gefahren zu beeinflussen oder zu verhindern. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass der Mensch seinem Schicksal nicht schutzlos ausgeliefert ist.
2. Das 32. Kapitel des Vaiḍūrya dkar-po
Die wichtigste Quelle zur tibetischen Geomantie stammt aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde von Desi Sanggye Gyatsho (sde-srid Sangs-rgyas rgya-mtsho) (1653–1705), dem Regenten des 5. Dalai Lama (1617–1682), verfasst. Der entsprechende Text heißt Vaiḍūrya dkar-po. Er behandelt verschiedene Bereiche der sino-tibetischen Divination (nag-rtsis), Astrologie und Astronomie; das 32. Kapitel behandelt die tibetische Geomantie.
Die Geomantie war für die Tibeter eine ernstzunehmende Wissenschaft und wurde vor dem Einmarsch der Chinesen, neben anderen Fächern wie Astrologie oder Astronomie im medizinisch-astrologischen Institut (sman-rtsis khang) in Lhasa anhand des Vaiḍūrya dkar-po unterrichtet. Zur Ausbildung des Geomanten gehörten: Das Erlernen der Berechnungsarten der nag-rtsis, das Betrachten und Interpretieren der Geländeformationen und das Studium der Rituale zur Abwehr möglicher Gefahren.
Der Regent Sanggye Gyatso beschreibt im ersten Abschnitt des 32. Kapitels des Vaiḍūrya dkar-po Landschaftsformen, die für die Errichtung von Gebäuden oder die Anlage von Leichenstätten ungeeignet sind. Er thematisiert auch architektonische Mängel eines bereits errichteten Gebäudes. In einem zweiten Abschnitt erklärt er die Charakteristika eines als Bauland geeigneten Geländes.
Vorraussetzung für eine Prüfung des Geländes, das als Baugrund infrage kommt, ist, dass der Tag der Untersuchung des Geländes günstig ist. Hierbei hat auch der Geomant gewisse Verhaltensregeln zu beachten. Er soll z.B. keine tibetisches Bier (chang) trinken, damit er konzentriert arbeiten kann. Erweist sich der Wochentag als günstig, sollte er Opfer an die Götter darbringen, um diese gnädig zu stimmen.
Drei einfache Prinzipien bestimmen die Wahl eines Geländes als Bauplatz:
1. Schlechte Stellen meidet man (ngan-pa spang)
2. Gute Stellen nimmt man (bzang-po blang)
3. Vor und während des Bauens führt man bestimmte Rituale durch (gdab-pa’i thabs).
3. Ungeeignetes Gelände
Im Vaiḍūrya dkar-po werden zunächst die Stellen aufgeführt, die für die Errichtung eines Gebäudes ungeeignet sind, wobei auch durchzuführende Rituale für den Fall beschrieben sind, dass an unpassenden Standorten bereits ein Gebäude errichtet wurde.
Die ungeeigneten wie auch die geeigneten Plätze werden jeweils bestimmten Kategorien zugeordnet, die keine uns erkennbare Systematik oder Logik aufweisen. So nennt Sanggye Gyatso:
– die „acht schlechten Vorzeichen“ eines Gebietes (sa yi ltas-ngan brgyad): Hierzu gehören Geländeeigentümlichkeiten, die als eingebeult wie ein Kupferklumpen, schlaff wie ein verrottetes Fell, weiß wie Knochen oder herabgleitend wie ein Falke beschrieben werden.
– die „acht kleinen Hindernisse“ (keg-phran brgyad). Hierzu gehört: ein Stück Land, das mit dem in einer Ackerfurche aufgekratzten Fußknöchel, einer ausgetrockneten Wasserlache oder einer Erdaufschüttung bei einem Leichnam verglichen wird.
– einen Berg, der wie die Stirn eines alten Menschen aussieht, oder einer Witwe gleicht, die eine zerrissene Decke trägt, oder der wie eine schwarze, sich nach unten schlängelnde Schlange aussieht. Dieser gehört zu den „acht Bergen, die schädigend auf den Boden wirken“ (’phung sa’i ri brgyad).
Aber nicht nur die Geländeformen, sondern auch die Farbe des Bodens ist ein Kriterium für divinatorische Aussagen und wird folgendermaßen gedeutet: Eine rote Bodenfarbe nennt Sanggye Gyatsho die Farbe des Messers. Sie zeige an, dass der Bewohner dieses Ortes in der Blüte seines Lebens erstochen werde. Gelber Boden - gelb ist die Farbe der Galle - bewirke, dass der Bewohner chronisch erkranke und auch an Nierenkrankheiten leiden werde. Auch der Ausschnitt am Himmel, den man in einem Tal sehen kann (lung-pa’i gnam-dbyibs), ermöglicht Vorhersagen: Die Form einer Steinschleuder gilt beispielsweise als schlechtes Zeichen. Man glaubt, sie verursache, dass der Bewohner des betreffenden Ortes eines Tages zum Bettler werde. Ähnelt der Himmel der Gestalt der gespannten Haut eines Toten, glaubt man, dass die Bewohner von ansteckenden Krankheiten befallen würden. Formen wie Skorpion, Schildkröte oder Schlange werden ebenfalls negative Wirkungen zugesprochen, sie sollen von Schlangengeistern (klu) verursachte Krankheiten begünstigen.
Auch die Formen der Äcker werden für divinatorische Aussagen genutzt: Heller Ackerboden gilt als schlecht. Ein dreieckiges Feld, das auch heute noch in Indien und Nepal als ungünstig gilt, bewirkt ein kurzes Leben und Schaden durch üble Nachrede. Erscheint das Feld wie die Öffnung eines Blasebalges, wird das Leben des Ackerbauern von kurzer Dauer sein und es kommt zu einem Generationsabbruch in der Familie.
4. Die "Erdfeinde“
Ein Abschnitt des Vaiḍūrya dkar-po widmet sich der sogenannten „Abfolge der Erdfeinde“ (sa-dgra’i rim-pa). Dies sind negative Merkmale, die weiter in äußere und innere differenziert werden. Die äußeren Merkmale sind negativ wirkende Formationen eines Geländes, die inneren Schädigungen aufgrund von Baumängeln, weil die angewandte Bauweise oder das Verhältnis des Baus zur Umgebung als schädigend betrachtet wird. Diese negativen Einflüsse können mit Ritualen abgewendet werden.
Sieht der „äußere Erdfeind“, also das Gelände, wie zwei sich streitende Menschen oder wie ein kämpfender Löwe aus, soll dies üble Nachrede, Krankheiten und Streitigkeiten auslösen. Abwehren kann man den drohenden Schaden mit folgendem Ritus: Man hebt von einer glückverheißenden Stelle einen dreieckigen Stein ohne Risse auf, schreibt mit Zinnober den Cintāmaṇi-Mantra darauf und führt eine Weihe durch. Dann hält man den Stein in die Richtung, aus der die Schädigung droht, und legt ihn schließlich nieder. Das soll den Schaden beseitigen.
Zu den „inneren Erdfeinden“, den Schädigungen aufgrund von Baumängeln, einer Bauweise oder einer ungünstigen Relation des Gebäudes zur Umgebung (nang nas gnod-pa) gehören u.a. die Anordnung der Türen, die Ausrichtung der Türen zueinander oder zu anderen Teilen eines Hauses, wie beispielsweise einer Mauerecke oder einer Treppe. Zumeist beschreibt der Autor die negativen Folgen und die Rituale, die zur Schadensvermeidung ausgeführt werden müssen. Durchgehend angeordneten Türen wird eine schädigende Wirkung im Hinblick auf Vermögen und Vieh nachgesagt, alle Bewohner derartiger Gebäude sind wegen übler Nachrede feindselig gegeneinander. Ein möglicher Schaden kann mit einem Löwen aus Ton, der nach außen gewandt aufgestellt wird, abgewendet werden.
Eine rissige Tür sollte man abdecken und über ihr das Hirschgeweih eines Zehnenders befestigen. Ist ein Weg auf die Tür gerichtet, sollte man eine Mauer bauen, so daß man den Türsturz und die Schwelle vom Weg aus nicht sieht.
5. Geeignete Bauplätze
Im zweiten Teil des Geomatie-Kapitels des Vaiḍūrya dkar-po beschreibt Sanggye Gyatso Plätze, die sich als Bauplätze eignen.
Ein ideales Gelände ist erfüllt von buddhistischer Symbolik. So ähnelt der Himmel den acht Speichen des Rades der Lehre, und die Erde sieht aus, als ob sich die acht Blätter eines Lotos entfaltet haben. An den Bergen glänzen die acht Glückszeichen.
Die als Bauplätze geeigneten Stellen ordnet der Regent wieder bestimmten Kategorien zu, zum Teil mit einem Hinweis auf die möglichen Folgen:
- „Acht Vermehrungen“ werden Berge genannt, deren Erscheinungsbild aufgehäufter Gerste oder Reis (nas-’bras) ähnelt. Errichtet man dort ein Gebäude, vermehren sich Menschen und Vermögen. Sieht der Berg wie der Kamm eines Hahns aus, vermehrt sich die gesamte Generation.
- Zu den „neunzehn guten schützenden Gebieten“ gehören solche, die wie eine aufgesteckte Pfeilfeder, ein ordentlich gehißtes Banner, ein Haufen aus Harnischen oder ein vorgezogener Vorhang aus weißer Seide aussehen.
Gebiete oder Berge, die eine Mehrung der Generationen (mi-rabs), aber auch der Entschädigungszahlungen wegen Mordes (mi-stongs) mit sich bringen, sehen wie ein weißer Löwe aus, der auf dem Gipfel eines großen Schneeberges (gangs-chen) im Osten zum Himmel springt, wie ein Türkisdrache, der im Süden zum Himmel springt oder wie ein leuchtender Pfau, der im Westen zum Himmel springt.
6. Der Nutzen von Geländebeschreibungen
Bei Gesprächen mit Tibetern kristallisierte sich schnell heraus, dass die vorstehenden Beschreibungen eines Geländes zur Orientierung genutzt wurden und die geomantische Tradition in Tibet sehr lebendig war.
Bis vor etwa 50 Jahren waren moderne Fortbewegungsmittel in den dünn besiedelten Hochgebirgsregionen von Tibet vollkommen bedeutungslos. Der Mensch reiste langsam, zu Fuß oder mit dem Pferd. Er besaß Zeit und Muße, die Umgebung eingehend zu betrachten und wahrzunehmen und derartige Beschreibungen markanter Plätze dienten, da es kaum Kartenmaterial gab, durchaus der Orientierung.
So erzählte mir Lobzang Chöpel (Blo-bzang chos-’phel), ein Tibeter, der im Jahre 2001 im Kloster Ze-phug in Karnataka/ Indien lebte, von seinen tagelangen Wanderungen durch das Hochgebirge. Er kannte die plastischen Beschreibungen der Berge auch vom Hörensagen und suchte bei seinen Wanderungen förmlich danach. So hatte er beispielsweise von einem Berg gehört, der wie ein Gehirn oder wie ein Tier mit heraushängenden Gedärmen aussehen sollte.
Betrachtet man die Lage der tibetischen Klöster in Tibet, Indien und Nepal genauer, so ist unverkennbar, daß geomantische Aspekte bei ihrer Errichtung eine Rolle spielten und die gesamte tibetische Kultur mitprägten. Aber auch beim Bau einfacher Wohnhäuser wurden sie berücksichtigt.
Der geeignete Bauplatz wird jedoch häufig anhand vielfältiger Faktoren gewählt, wie die Lage des Klosters Ganden (dGa’-ldan) in Zentraltibet bei Lhasa verdeutlicht:
Das Kloster Ganden, eines der einstmals größten Klöster der Gelugpa-Schule, war von dem bedeutenden Gelehrten Tsongkhapa (1357–1419) auf Bitten seiner Schüler errichtet worden. Es steht am Hang des Berges Wangkur (dBang-bskur), das ist der Berg, auf dem der Tradition nach der erste tibetische Großkönig Songtsen Gampo (Srong-btsan-sgam-po, reg. 627–649) in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts den Thron bestiegen hatte. Da auch Tsongkhapa hier Meditationsübungen und Gebete verrichtet hatte, galt der Berg als besonders geeignet. Außerdem bestätigte ein Orakel, dass dort der Platz sei, der für die Errichtung eines Klosters in Frage komme. Das Kloster liegt an einem steilen, hohen Bergrücken, nach Aussage tibetischer Mönche eine Umgebung, die sich für den Klosterbau besonders eignet. Vom Kloster aus kann man durch das gesamte Tal bis nach Reting (Rva-sgreng) blicken, einem anderen wichtigen Gelugpa-Kloster.
 |
Abbildung 2: Lage des Klosters Ganden |
Die Errichtung von Klöstern wird also meist bestimmten historischen Persönlichkeiten zugeschrieben und erfolgt an landschaftlich markanten Plätzen (sa-dmigs). Sie stehen oft an für Tibeter heiligen Stätten, unter Umständen auch an heiligen Plätzen der Hindus und dienen, wie Stūpas und andere Sakralbauten auch, der Festigung und Verbreitung des Buddhismus sowie der Befriedung des Landes und der Grenzen.
Um mir einen größeren Überblick über die tatsächliche Praxis zu verschaffen, befragte ich tibetische Informanten, die auf irgendeine Weise an Bauvorhaben beteiligt waren. Hierunter waren Handwerker, beispielsweise Schreiner, aber auch Astrologen bzw. Divinationsmeister (rtsis-pa) oder einfache Mönche, die Kenntnisse über Berechnungen oder zu Ritualen hatten, die mit der Errichtung von Gebäuden verbunden sind. Ihre Antworten waren sehr von den jeweiligen persönlichen Erfahrungen und dem erlernten Wissen geprägt.
Folgende geomantische Prinzipien nannten die Informanten immer wieder. Sie können daher für die Wahl eines guten Bauplatzes als eine Art Allgemeinwissen angesehen werden:
1. Eine Wasserquelle sollte in der Nähe sein.
2. An der Rückseite eines zu errichtenden Gebäudes sollte ein Berg liegen.
3. Die Eingangstür sollte nach Osten ausgerichtet werden.
4. Flussmündungen oder sich kreuzende Flüsse in unmittelbarer Nachbarschaft sollten gemieden werden.
Betrachtet man sich diese Regeln näher, so wird schnell klar, das es sich hierbei auch um Erfahrungswissen handelt: Es bedarf sicher keiner weiteren Erläuterung, dass Wasser für jede bewohnte Siedlung notwendig ist. Flussmündungsgebiete sind oft Hochwassergebiete und die Bauwerke sollten in einer gewissen Entfernung davon stehen.
7. Geomantische Vorstellungen und das Verhältnis der Tibeter zur Natur
Bei der Beschäftigung mit der tibetischen Geomantie stellte sich die Frage, welches Verhältnis Tibeter zur Natur haben. Diese Frage ergab sich vor allem daraus, dass in den Beschreibungen der geomantischen Texte selten natürliche Erscheinungen als solche beschrieben werden. Ein Gelände wird überwiegend anhand von Alltags- oder Sakralgegenständen, anhand des Äußeren bzw. anhand von Körperteilen eines Menschen oder Tieres beschrieben, während die natürliche Umwelt an sich nicht erfasst wird.
Dies ist sicherlich umso erstaunlicher, da die Literatur über Tibet und die Tibeter tendenziell von einem idealen Mensch-Natur-Verhältnis ausgeht. Tibeter werden meist aufgrund ihres buddhistischen Glaubens als „im Einklang mit der Natur“ lebende Menschen charakterisiert. Natur meint hier in erster Linie die natürliche Umwelt, die den Menschen umgebenden Raum, der ohne sein Handeln entstanden ist. Diese Thematik kann hier wegen ihrer Komplexität nur angerissen werden.
Unter dem Einfluss der sino-tibetischen Divinationskalkulationen (nag-rtsis), die vor allem im 17. Jh. in Tibet an Bedeutung gewannen, setzte sich zunehmend die chinesische Vorstellung von den fünf Elementen Erde (sa), Wasser (chu), Feuer (me), Holz (shing) und Metall bzw. Eisen (lcags) durch, die für verschiedene Aspekte der Geomantie wesentlich sind. Diese Elemente legen beispielsweise in Verbindung mit bestimmten Determinanten (spar-kha, sme-ba etc.), die jeder Person und damit jedem Bewohner oder Erbauer zugeordnet sind, nicht nur die Lage eines Berges zu einem Gebäude fest, sondern sie bestimmen auch den Baubeginn und damit einen für die Divination weiteren entscheidenden Faktor, nämlich die Zeit. Den Vorstellungen der nag-rtsis zufolge setzt sich nämlich nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit aus den fünf Elementen zusammen, die somit das Leben eines Menschen und seine Aktivitäten ganz entscheidend beeinflussen. So ist bei der Errichtung von Gebäuden nicht nur der geeignete Raum, sondern auch die Zeit des Baubeginns, die beispielsweise durch das Geburtsjahr des künftigen Bewohners oder Bauherrn determiniert ist, ausschlaggebend dafür, dass die künftigen Bewohner in Zufriedenheit leben können.
Der Mensch muss also seine natürliche Umgebung bzw. die Natur deuten, um zu überleben, gesund zu bleiben und die Umwelt in rechter Weise nutzen zu können. Hierzu gehört auch die Kultivierung des Landes durch Ackerbau, denn auch bei der landwirtschaftlichen Bearbeitung des Bodens sind, wie beim Hausbau, gewisse Regeln zu beachten. Die Gottheiten und Dämonen im Boden sollten zur Vermeidung von Schaden nicht gestört werden, der Mensch sollte sie mit Opfern günstig stimmen, wenn er das Land – in welcher Form auch immer – nutzen will. Damit sind auch die Nutzung der Bodenschätze und Ausbeutung der Natur eng begrenzt: So war in Tibet das Waschen von Gold aus Flüssen erlaubt, die Goldgräberei jedoch nicht. Und der Mensch musste in jedem Fall, bevor er in die Natur und damit in den Raum der sie bevölkernden Wesen eingriff, spezifische Rituale für die Erdgottheiten auszuführen.
Diese Vorstellung von einer mit Wesen belebten Umwelt oder Natur weist auf ein magisch-mythisches Weltbild hin, das teilweise bis heute bei den Tibetern anzutreffen ist. Das Land selbst wird als eine Dämonin oder aber, was häufiger ist, als von Wesen bewohnt angesehen, die anthropomorph, zoomorph oder Mischwesen beider, wie z.B. der Sa-bdag lto-’phye, sein können.
Auch die Verwendung des zuvor genannten Terminus Erdfeind (sa-dgra) verdeutlicht die Sichtweise der natürlichen Umwelt. Hierbei unterscheidet man drei Arten von „Erdfeinden“: den, der auf natürliche Weise existiert; den, der geschaffen wurde, und den spontan Entstandenen. Das heißt: Auf natürliche Weise existiert ein Erdfeind aufgrund der entsprechenden natürlichen Beschaffenheit eines Gebietes, hervorgebracht wird er durch ungeeignete bauliche Maßnahmen und spontan entsteht er, ohne dass erkennbare äußere Ursachen vorliegen. Mit anderen Worten: Ein Gelände kann, allein wegen seiner Topografie als negativ bzw. feindlich oder aber auch, wenn das Aussehen eines Geländes nicht als „Erdfeind“ klassifiziert wird, als glückverheißend (bkra-shis-pa) eingestuft werden. Damit wird eine ambivalente Haltung zur natürlichen Umwelt deutlich.
Eine – unter indischem Einfluss stehende – Sichtweise der Natur und der Welt im Allgemeinen wird beispielsweise in dem tibetischen Werk Shes-bya rab-gsal deutlich, dass nämlich der Raum und damit die Elemente (’byung-ba) auf den Menschen einwirken. In dieser auf der indischen skar-rtsis, der Kalkulation der Sterne, basierenden Abhandlung, legt ’Phags-pa seine Sicht vom Aufbau der Welt dar. Danach bestehen die Welt und die Lebewesen aus vier Elementen (’byung-ba), das sind Erde (sa), Wasser (chu), Feuer (me) und Wind (rlung), denen bestimmte Eigenschaften (fest, flüssig, warm und beweglich) zugeteilt werden. Er unterscheidet hierin zwischen der Welt des Behältnisses (snod), d.h. der unbelebten Welt, also den Meeren, Bergen, Flüssen etc., und der Welt des darin Enthaltenen (bcud), d.h. der durch die sechs Gruppen von Wesen belebten Welt. Diese Vorstellungen, die auch im Vaiḍūrya dkar-po aufgenommen wurden, können einen Erklärungsansatz für das Prinzip bieten, auf dem die tibetische Geomantie beruht: Die Welt, das äußere Gefäß, übt eine Wirkung auf das aus, was „in dem Gefäß enthalten ist“, also auf alle Lebewesen und Pflanzen.
Dies erinnert an den Mythos, wonach die ersten Tempel in Tibet und im angrenzenden Bhutan an bestimmten Stellen errichtet werden mussten, um damit das Land, das als eine rücklings liegende Dämonin vorgestellt wurde, überhaupt bewohnbar und zivilisierbar zu machen, d.h., mit diesen Tempeln bezwang man die Dämonin, beeinflusste die natürliche Umgebung und ermöglichte dem Menschen erst eine Nutzung des Landes.
Diese geomantischen Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem die Fähigkeit eine Landschaft zu betrachten und zu beurteilen, werden im gesamten tibetischen Kulturraum, d.h. in Tibet und in den von Tibetern besiedelten Gebieten Indiens und Nepals, kaum noch vermittelt. Die Tradition ist lediglich noch einigen Gelehrten bekannt, die nur noch wenige Schüler unterrichten. Lediglich die Rituale, die direkt mit dem Bau eines Gebäudes oder der Anlage einer Leichenstätte, also mit der Inbesitznahme des Bodens verbunden sind, werden weiter tradiert.
Nach Karma Geleg (dKar-ma dge-legs), im Jahre 2001 Staatssekretär des Departments of Religion der Tibetischen Exilregierung in Dharamsala, zeigt beispielsweise die jüngere Generation der Mönche ein nur geringes Interesse für die Geomantie. Heutzutage unterliegen die Mönche einem immer stärker werdenden Einfluss säkularen Denkens, und das Studium der einheimischen tibetischen Wissensgebiete sei für viele nur noch marginal, sodass nur noch wenige ein profundes Wissen in den verschiedenen Fachrichtungen aufwiesen.
8. Literatur
Petra Maurer: Die Grundlagen der tibetischen Geomantie dargestellt anhand des 32. Kapitels des Vaiḍūrya dkar po von sde srid Sangs rgyas rgya mtsho (1653–1705). Ein Beitrag zum Verständnis der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte Tibets zur Zeit des 5. Dalai Lama Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (1617–1682). Halle 2009.
’Phags-pa Blo-gros rgyal-mtshan 1968: Shes-bya rab-gsal. In: The Complete Works of Chos rgyal ’Phags pa. The Complete Works of the Sa skya Sect of the Tibetan Buddhism, Vol. 6. The Toyo Bunko. Tokyo (Bibliotheca Tibetica 1-6).
Sangs-rgyas rgya-mtsho: Phug lugs rtsis kyi legs bshad mkhas pa’i mgul rgyan bai ḍūrya dkar po’i do shal dpyod ldan snying nor shes ba ba, sDe dge-Ausgabe.
Lambert Schmithausen 1991: Buddhism and Nature. The Lecture delivered on the Occasion of the EXPO 1990. Tokyo (Studia Philologica Buddhica. Occasional Paper Series VII).
Dieter Schuh 2004: Politik und Wissenschaft in Tibet im 13. und 17. Jahrhundert. In: Zentralasiatische Studien 33, S. 1-24.
Autorin: Petra Maurer, 2011